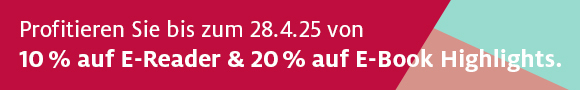Die mündige Universität
Werner Müller-Esterl, Christine Burtscheidt
Tiefpreis
CHF22.40
Auslieferung erfolgt in der Regel innert 3 bis 4 Wochen.
Beschreibung
Mit der Umwandlung zur autonomen Stiftungsuniversität 2008 ist die Frankfurter Goethe-Universität zu ihren Wurzeln zurückgekehrt: 1914 wurde sie von Bürgern für Bürger gegründet. Zugleich hat sie sich mit dem neuen Status an die Spitze der deutschen Reformbewegung gesetzt. Diese zielt seit 16 Jahren auf mehr Wettbewerb und Differenzierung im deutschen Wissenschaftssystem. Das Buch versteht sich als Plädoyer für den "Frankfurter Weg", der in seiner Art bundesweit einmalig ist. Es stellt erreichte Erfolge der vergangenen Jahre ebenso dar wie Probleme und Herausforderungen und kann damit auch jenen Orientierung geben, die sich auf einem ähnlichen Weg befinden.
Autorentext
Werner Müller-Esterl, Prof. Dr., ist Präsident der Universität Frankfurt am Main. Er hatte Professuren für Klinische Biochemie in München, Mainz und Frankfurt am Main und leitete hier auch den Exzellenzcluster »Makromolekulare Komplexe«. Christine Burtscheidt, Dr. phil., ist persönliche Referentin des Präsidenten, nach Stationen als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der LMU München und als Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung.
Klappentext
Mit der Umwandlung zur autonomen Stiftungsuniversität 2008 ist die Frankfurter Goethe-Universität zu ihren Wurzeln zurückgekehrt: 1914 wurde sie von Bürgern für Bürger gegründet. Zugleich hat sie sich mit dem neuen Status an die Spitze der deutschen Reformbewegung gesetzt. Diese zielt seit 16 Jahren auf mehr Wettbewerb und Differenzierung im deutschen Wissenschaftssystem. Das Buch versteht sich als Plädoyer für den »Frankfurter Weg«, der in seiner Art bundesweit einmalig ist. Es stellt erreichte Erfolge der vergangenen Jahre ebenso dar wie Probleme und Herausforderungen und kann damit auch jenen Orientierung geben, die sich auf einem ähnlichen Weg befinden.
Leseprobe
Die erweiterte Universitäts-Gemeinschaft: Lehren, lernen - und bürgen
Matthias Kleiner, Vorsitzender des Hochschulrates der Goethe-Universität Frankfurt
"Die mündige Universität" - dieser Titel provoziert Fragen: Mündig - eine Universität? Ist Mündigkeit nicht eine Eigenschaft und ein Vorrecht des Menschen? Gibt es denn Universitäten oder in einem weiteren Sinne verwandte Institutionen in der Wissenschaft, auf die das Attribut nicht oder weniger zutrifft? Sind Universitäten in Deutschland unterschiedlich mündig?
Mündig, das heißt ja in erster Linie, kundig selbst Verantwortung zu tragen - für die Gegenwart wie für die Zukunft. Darin liegt auch schon eine der Antworten: Dieses Selbst, das ist die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden, wie es so schön heißt; eine Gruppe von Menschen also, die eine Universität ausmacht und die Überzeugung von und den Aufwand der Mündigkeit nicht scheut. Die Frankfurter Universität ist eine solche Gemeinschaft. Sie hat sich bereits vor mehr als 100 Jahren auf diesen Weg gemacht und das Bekenntnis dazu jüngst bekräftigt, als sie 2008 in eine selbstständige Stiftungsuniversität umgewandelt wurde.
Doch eine solche Umwandlung geschieht nicht auf einmal oder gar auf Knopfdruck - am Beispiel Frankfurt lassen sich vielmehr zwei Prozesse der Initiation ausmachen, die einander wohl bedingt haben: Erstens war die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden hier um Bürgerinnen und Bürger der Stadt erweitert, die den freiheitlichen Anspruch auf eine universitäre Gemeinschaft bekräftigten - und dafür im Wortsinn bürgten. Dass die Bewegung der Goethe-Universität hin zur wachsenden Autonomie eben auch aus der Mitte der Bürgerschaft entsprang, verleiht der verantwortungsvollen Unabhängigkeit der Institution Universität vor aufgeklärtem Hintergrund gerade in Frankfurt einen besonderen Nachdruck. Wer weiß, womöglich ist die Goethe-Universität daher tatsächlich ein wenig mündiger als andere - oder geübter darin, es auf eine selbstverständliche Weise zu sein
Zweitens hat die wissenschaftsbezogene und daher wissenschaftsgeleitete innere Entwicklung notwendige Schritte der Befähigung vollzogen: Mit einer eigenen wissenschaftlichen Identität, vorausschauenden Perspektiven, die in nachhaltigen Konzepten münden, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stets im Blick, kritische Überprüfungsmechanismen zur Sicherstellung der Qualität und einer festen Zusammengehörigkeit, wenn nicht Einheit von Lehre und Forschung. Nicht zuletzt gehört dazu der lebendige Austausch mit der Stadt und ihrer Gesellschaft.
Die Vorstellung der Mündigkeit mag im Kontext der Wissenschaften dem Prinzip der Selbstorganisation der Forschung eng verwandt sein und in anderen gesellschaftlichen Bereichen Subsidiarität heißen; gemeinsam ist diesen Spielarten die Berufung auf Kompetenz und Selbstbestimmung sowie Sachverstand und Entfaltung auf der Ebene der jeweils zuständigen Einheiten und Instanzen - systematisch und transparent in Organisation und Aufbau und zum Wohle des Ganzen. Natürlich steckt auch ein motivierendes Moment in der Mündigkeit, in der Selbstorganisation oder in der Subsidiarität: Es erlaubt, fördert und fordert das Können, das Wollen und die Initiative der Beteiligten.
Ein national singuläres Konstrukt wie die Frankfurter Stiftungsuniversität steht natürlich in besonderer Weise im Fokus: Gelingt es? Gelingt es nicht? Darüber berichtet das Buch. Jeder Weg ist selbst zu erproben, alle Erfahrungen gilt es, selbst zu machen. Es bedarf - wie so häufig in Wissenschaft und Forschung - der rechten Balance von Tat und Anstrengung hier und Geduld und Muße dort. Insofern verstehe ich dieses Buch als Anreiz für Lehrende und Lernende, also für alle Angehörigen der erweiterten Universitäts-Gemeinschaft, aber auch über Frankfurt hinaus für alle, die sich mit Wissenschaft, Forschung und Lehre befassen und für sie interessieren.
Der Frankfurter Weg in die Autonomie
Wie alles begann
Die Paulskirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Schulter an Schulter stehen BürgerInnen und ProfessorInnen bis zum Treppenabstieg in die Halle hinunter. Zwei Männer gehen mit ausgestreckten Armen aufeinander zu. Es folgt ein Handschlag und dann tosender Applaus. Die höchsten Vertreter von Stadt und Universitätsspitze haben soeben versichert, "gemeinsam in die Zukunft zu gehen". Eine Geste, für die es in Frankfurt keinen symbolischeren Ort geben könnte; aber auch keinen besseren Zeitpunkt als den Neujahrsempfang der Stadt, der im Januar 2014 gleichzeitig Auftakt zur Hundertjahrfeier der Frankfurter Universität ist.
Wenngleich auch die Universität 1914 "aus der Mitte der Stadtgesellschaft" hervorgegangen ist, schien lange die Distanz zwischen Stadt und Universität unüberbrückbar groß - hier die äußerst heterogene Bürgerschaft einer internationalen Handelsmetropole, dort die von Wiesbaden aus verwaltete Landesuniversität. Eine Nähe zur Stadt entstand erst wieder, als die Universität 2008 - orientiert an international erfolgreichen Vorbildern - den Status einer autonomen Stiftungsuniversität errang. Denn damit besann sie sich ihrer Herkunft - der Liberalität, Pluralität und Internationalität ihrer Stadt.Reformtendenzen der vergangenen Dekaden
"Die Idee der Umwandlung der Goethe-Universität in eine Stiftungsuniversität wäre undenkbar gewesen ohne die weitreichenden Veränderungen, die sich seit Mitte der neunziger Jahre auf dem Universitätssektor ereignet haben", ist in einer der vielen universitären Chroniken nachzulesen. Damit wird auf die vierte Novelle des Hochschulrahmengesetzes des Bundes (HRG) verwiesen sowie den sich daran orientierenden zahlreichen Ländergesetzgebungsprozessen. Sie lösten einen Paradigmenwechsel in der Hochschulpolitik aus: weg von staatlicher Detailsteuerung, hin zu mehr institutioneller Freiheit für die Universitäten.
Die wesentlichen Ursachen dafür waren: die mittelmäßige bis sinkende Lehr- und Forschungsqualität staatlich gesteuerter Einrichtungen, sichtbar geworden durch aufkommende internationale Rankings; ein wachsender…