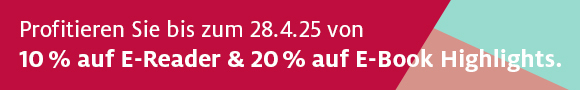Der aktivierende Wohlfahrtsstaat
Tiefpreis
CHF49.75
Exemplar wird für Sie besorgt.
Kein Rückgaberecht
Beschreibung
Das neue wohlfahrtsstaatliche Leitbild aktivierender Arbeitsmarktpolitik zielt auf Beschäftigungsfähigkeit und knüpft finanzielle Leistungen an die Pflicht zur Arbeitsuche. Irene Dingeldey untersucht entsprechende Reformen in Deutschland, Großbritannien und Dänemark seit den 1990er-Jahren. Ihre Ergebnisse untermauern das Entstehen verschiedener Aktivierungsvarianten, die jeweils durch die Flexibilisierung der Arbeitsformen, den Ausbau finanzieller Anreize oder soziale Dienstleistungen geprägt sind. Welche Variante umgesetzt wird, hängt von den institutionellen Ausgangsbedingungen ab sowie von der Form der Einbindung verschiedener staatlicher und gesellschaftlicher Akteure.
Autorentext
Irene Dingeldey, Dr. rer. soc., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen.
Leseprobe
Zentrale Ziele des Wohlfahrtsstaates sind die Gewährleistung sozialer Rechte und der soziale Ausgleich (Kaufmann 1997: 22; Marshall (1949) 1963). Um diese Ziele erfüllen zu können, muss der Wohlfahrtsstaat zwischen den verschiedenen Gesellschaftsbereichen Staat, Markt und Familie und den diesen zu Grunde liegenden widersprüchlichen Funktionsbedingungen vermitteln (Kaufmann 2002b: 278). Angesichts der sich verändernden wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen ist dazu eine beständige Anpassung der konkreten Ausgestaltung sozialer Rechte wie auch wohlfahrtsstaatlicher Institutionen und Programme an neue Bedürfnisse und Herausforderungen notwendig. Das von Wolf Biermann formulierte Paradoxon der Notwendigkeit von Wandel als Voraussetzung für Kontinuität charakterisiert daher äußerst treffend die Dynamik der Wohlfahrtsstaatsentwicklung. In der vielfach als goldenes Zeitalter des Wohlfahrtsstaates bezeichneten Nachkriegszeit galt der fürsorgende oder versorgende Wohlfahrtsstaat als dominantes Paradigma für sozialstaatliches Handeln in den westlichen Ländern. Folgt man der Argumentation von Esping-Andersen (1990) und anderen (Bonoli 2007b: 25), wurden der Ausbau der Dekommodifizierung, also die Existenzsicherung unabhängig von Markteinkommen, sowie die Angleichung der Markteinkommen über sozialstaatliche Umverteilung als zentrale sozialpolitische Ziele verfolgt. Dies basierte auf einem Verständnis des Staates als planendem oder steuerndem Interventionsstaat, der unter anderem mit Hilfe der keynesianischen Makrosteuerung, die entsprechenden ökonomischen Voraussetzungen in Form von wirtschaftlichem Wachstum und Vollbeschäftigung schaffen sollte (Dingeldey 2006b). Die verschiedenen von Esping-Andersen (1990) als liberal, konservativ-korporatistisch und sozialdemokratisch-universalistisch typologisierten Wohlfahrtsstaatsregime belegen dabei, dass die entsprechenden Ziele in den einzelnen Ländern nicht nur im Rahmen unterschiedlicher historisch gewachsener institutioneller Arrangements entlang verschiedener Normen und Prinzipien umgesetzt, sondern auch jeweils mit durchaus unterschiedlichem Erfolg erreicht wurden. Spätestens seit den 1970er Jahren entstanden jedoch neue Herausforderungen und soziale Problemlagen, welche die mit dem Paradigma des fürsorgenden Wohlfahrtsstaates verbundenen Ziele und Instrumente sowie das damit einhergehende Problemlösungspotential generell in Frage stellten. Zu nennen sind hier unter anderem die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft, welche die keynesianische Steuerung restringierte beziehungsweise deren weitgehendes Versagen bei der Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit verdeutlichte (Scharpf 1987). Ferner wurde die Finanzkrise des Staates unter anderem auf permanent steigende wohlfahrtsstaatliche Ausgaben zurückgeführt. Damit wurden vor allem kompensatorische, finanzielle Leistungen beziehungsweise das Ziel einer umfassenden Dekommodifizierung zunehmend diskreditiert. Gleichzeitig zeigten die etablierten Instrumente und Programme Defizite hinsichtlich der Absicherung so genannter neuer sozialer Risiken, die aufgrund der zunehmenden Prekarisierung von Erwerbstätigen sowie der Auflösung der traditionellen Familienformen entstanden (Bonoli 2007a; Pierson 2001a). Vor diesem Hintergrund entwarfen sowohl nationale als auch internationale Akteure neue wohlfahrtsstaatliche Leitbilder, um die konkreten Ziele sowie Programme und Institutionen an die veränderten Herausforderungen anzupassen. Seit Ende der 1980er Jahre werden die entsprechenden Reformdiskurse von Seiten der OECD oder der EU durch die Entwürfe einer "Active Society" oder "Activating Policies" (Lefresne 1999; OECD 1989) geprägt. Die diesen Entwürfen zu Grunde liegenden Ideen wurden nicht zuletzt von ideologischen Wegbereitern und Politikberatern der nationalen Regierungen und Parteien entwickelt und beeinflusst. Beispielhaft zu nennen sind hier Publikationen, die einen "Social Investment State" (Giddens 1998a) oder einen "Enabling State" (Gilbert/ Gilbert 1989; Gilbert 2002) als Ziel des Wandels skizzierten beziehungsweise dahingehende Entwicklungen positiv bewerteten. Andere wiederum haben die entsprechenden Reformpolitiken als Transformation vom "Keynesian Welfare State to the Schumpeterian Workfare State" (Jessop 1994) kritisch kommentiert. Als am wenigsten normativ überfrachtet kann in diesem Zusammenhang die These des wohlfahrtsstaatlichen Paradigmenwechsels vom "fürsorgenden zum aktivierenden Staat" betrachtet werden (Dingeldey 2006b). Grundlegend für die genannten Entwürfe ist, dass sozialstaatliche Ziele wie Freiheit und Gleichheit im Sinne einer Steigerung der Eigenverantwortung und sozialer Teilhabe reinterpretiert werden. Im Rahmen einer Politik, die sozialen Risiken präventiv begegnen will, werden die im Rahmen einer fürsorgenden Sozialpolitik gewährten universalisierten Rechtsansprüche auf standardisierte materielle Leistungen abgebaut und durch individualisierte und konditionalisierte Leistungen ersetzt. Im Vordergrund steht dabei die Arbeitsmarktaktivierung, womit die Kommodifizierung der Individuen zum vorrangigen Ziel staatlicher Steuerungsintentionen wird. Der bereits vollzogene Übergang zu einer angebotsorientierten Wirtschaftssteuerung wird nunmehr durch einen massiven Umbau hin zur aktivierenden Arbeitsmarktpolitik ergänzt und das Vollbeschäftigungsziel weitgehend durch das Ziel der Förderung von Beschäftigungsfähig ersetzt. Bislang noch wenig Aufmerksamkeit fand dabei, dass das neue Paradigma neben dem Wandel von Welfare auch einen Wandel von State impliziert. Das zweite oben angeführte Zitat des ehemaligen deutschen Kanzleramtsministers Bodo Hombach unterstreicht jedoch genau diesen Aspekt, indem die veränderten sozialstaatlichen Zielsetzungen mit dem Wandel des Steuerungsmodells beziehungsweise von Governance verbunden werden. Dies lässt sich vordergründig auf die Arbeitsteilung zwischen staatlichen und privaten Akteuren beim Regulieren, Erbringen und Finanzieren sozialer Leistungen beziehen. Wesentlicher erscheint jedoch eine damit einher gehende Neudefinition der Rolle des Staates.
Inhalt
Inhalt Vorwort 13 Einleitung 17 I. Reflexion des wohlfahrtsstaatlichen Wandels und der Arbeitsmarktpolitik in der wissenschaftlichen Literatur 1. Neue wohlfahrtsstaatliche Leitbilder und Paradigmen 33 1.1 Social Investment State 34 1.2 Aktivierender Sozialstaat 36 1.3 Enabling State 38 1.4 Workfare State 39 1.5 Zwischenresümee 40 2. Staat, Steuerung und Governance 42 2.1 Zum Wandel von Staatlichkeit und politischer Steuerung 44 2.2 Governance-Diskurs 47 2.3 Neue Staatsvorstellungen 55 2.4 Zwischenresümee 58 3. Forschungsstand zum Wandel des Wohlfahrtsstaates und der Arbeitsmarktpolitik 60 3.1 Verschiedene Konzeptionen des Wandels von Wohlfahrtsstaatlichkeit 61 3.2 Das "Dependent Variable Problem" 66 3.3 Erklärungsansätze zur Entwicklung des Wohlfahrtsstaates und zum Erfolg von Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 77 3.4 Zwischenresümee 96 4. Fazit zur Reflexion der wissenschaftlichen Literatur 99 II. Theoretisch konzeptionelle Entwicklung eines vergleichenden Forschungsdesigns 5. Der Wohlfahrtsst…
Produktinformationen
Weitere Produkte aus der Reihe "Schriften des Zentrums für Sozialpolitik Bremen"
Tief- preis
- Der aktivierende Wohlfahrtsstaat
- Irene Dingeldey