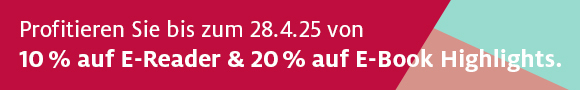Reiz des Unterirdischen: Diachrone Betrachtung von Vorstellungswelten über das Subterrane am Beispiel von ausgewählten Höhlen im Harz
Tiefpreis
CHF30.70
Print on Demand - Exemplar wird für Sie besorgt.
Beschreibung
In dieser Bachelorarbeit werden die kulturellen Wahrnehmungs- und Deutungsmuster über das Subterrane in der Frühen Neuzeit am Beispiel ausgewählter Höhlen im Harz untersucht. Die Arbeit versteht sich als eine historisch-anthropologische Studie, die sich konzeptuell im Kontext der Forschungen über Naturphänomene in der Frühen Neuzeit sowie über historische Reisekultur verortet. Grundlage der Studie sind 30 Erlebnisberichte über Höhlenfahrten vom 17. bis zum frühen 19. Jahrhundert, die mit Hilfe texthermeneutischer Verfahren interpretiert werden. Es wird gezeigt, dass Höhlen in der Frühen Neuzeit u.a. als außergewöhnliche Naturobjekte wahrgenommen wurden, die man aus verschiedenen Motivationen heraus erkundete. Anhand der beschriebenen Höhlenexkursionen wird ebenso auf die Naturwahrnehmung und deren Veränderungen eingegangen wie auf die (weitere) Entwicklung der wirtschaftlichen Nutzung (etwa in Form touristischer Reisen) und die wissenschaftliche Erforschung dieser Naturphänomene.
Autorentext
Franziska Völkel, B.A., wurde 1990 in Leinefelde (Eichsfeld) geboren. Im Jahr 2013 schloss sie ihren Zweifach-Bachelor-Studiengang in den Fächern Kulturanthropologie/ Europäische Ethnologie und Geschichtswissenschaft an der Georg-August-Universität in Göttingen ab. Ihre Interessen- und Arbeitsfelder sind vor allem im Bereich der Historischen Anthropologie zu verorten.
Leseprobe
Textprobe:
Kapitel 5, Erkundung des subterranen Raums:
5.1, Beschreibung der Befahrungsmodalitäten:
5.1.1, Widrigkeiten der Höhlenexkursion:
Das Befahren der Höhlen im Harz war am Beginn der Frühen Neuzeit äußerst beschwerlich, wie die Quellen berichten. Erst im Verlauf des 18. Jahrhunderts wurden sie weiter erschlossen und für die Besucher ausgebaut, dennoch musste mit Unannehmlichkeiten gerechnet werden. Die Erkundung dieser unterirdischen Landschaft war dement-sprechend im Untersuchungszeitraum durchgehend mit körperlichen Anstrengungen verknüpft. Im Verlauf dieses Abschnitts soll nun auf die Bedingungen der Befahrung und die physischen Befindlichkeiten während eines Höhlenbesuchs eingegangen wer-den, um nachvollziehen zu können, wie dadurch bestimmte Vorstellungswelten über das Subterrane konstituiert wurden.
In fast allen Quellen werden die Modalitäten vor dem Gang in die Höhle beschrieben. Zunächst war es notwendig, einen Führer auszumachen, der anschließend mit Trink-geld bezahlt wurde. Die Familie Becker aus Rübeland wurde ab 1668 durch die Obrigkeit privilegiert, Besichtigungen in der Baumannshöhle durchzuführen. Die Höhle wurde ferner mit einer Tür vor Unbefugten verriegelt, sodass das eigenständige Befahren nicht möglich war. In der Einhornhöhle übernahmen Ortsansässige gegen Entlohnung die Führung. Es lässt sich feststellen, dass ein Wegweiser in der unterirdischen Landschaft notwendig war, da er die benötigte Ausrüstung stellte sowie durch seine Kenntnis der Gänge die Besucher auf die richtigen Pfade leitete. Der Topos des Verirrens und die damit einhergehende Angst sind in den Texten sehr häufig zu finden und oft mit dem Motiv des Labyrinths als symbolische Beschreibung für die Höhle verbunden. In einigen Quellen wird die Furcht vor dem Gefangen-Sein im subterranen Raum durch tradierten Geschichten über Höhlenerkunder unterstrichen, die mehrere Tage vergebens im Unterirdischen umherirrten, dann ausgezerrt den Weg nach außen fanden und kurz danach im Wahn starben. Der Verweis auf die Thematik des Wahns sollte ex negativo zur Befolgung der Regeln des Höhlenführers beitragen, denn dann kann der Besucher ohne einziges Irre-Gehen gut und wohl daraus kommen .
Eine erste ausführliche Beschreibung des Ablaufs der eigens durchgeführten Befahrung der Baumannshöhle liefert Kolodey (1668), der im Sommer 1653 mit einer Gesellschaft in den Harz reiste. Er beschreibt, wie sie den Führer in dem kleinen Ort Rübeland auf-suchten und von diesem zur Höhle geleitet wurden. Im Folgenden wird erwähnt, dass die Gruppe Gegenstände und Kleidungsstücke ablegen musste, so uns in die Höle reinzugehen verhinderlich seyn können . Auch Behrens (1703) gibt den Hinweis, dass es wichtig sei, die Bergkleidung anzuziehen, wenn sie [die Kompagnie der Höhlenbesucher] anders nicht im Durchkriechen derer Hölen ihre Kleider mit Staub- und Koht abscheulich besundeln und verderben auch wohl gar zu ihrem Schaden noch Spott haben wollen . Die Bekleidung konnte auch Amüsement hervorrufen, wie Behrens am Beispiel eines curieuse[n] Frauen-Zimmer[s] berichtet, über derer Posituren sich auch mancher melancholischer Sauer-Tropff hätte zu Schanden lachen müssen . Bei Kundmann (1737) werden auch Frauenzimmer erwähnt, denen, wenn sie keine Hosen angehabt, [die Erkundung] sehr beschwerlich gefallen sei. Es kann durch die Teilnahme der Frauen an der Besichtigung davon ausgegangen werden, dass Thrill , also der Nervenkitzel durch das Erleben gefährlicher beziehungsweise außergewöhnlicher Situationen, keine rein männliche Intention darstellte. Die Verbindung der vordergründigen Problematik der Unangemessenheit der Kleidung mit der Betonung der geschlechtsspezifischen vestimentären Codes bringt zum Vorschein, dass Frauen als nicht geeignet für die Höhlenexkursion angesehen wurden. Es wurde sich durch die Hervorhebung der visuellen Attribute von dem relational konstruierten Geschlecht Frau abgegrenzt.