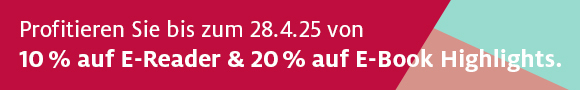Humboldts falsche Erben
Tiefpreis
CHF33.90
Exemplar wird für Sie besorgt.
Kein Rückgaberecht
Beschreibung
Knapp 200 Jahre nach Humboldts Proklamation der Wissenschaftsfreiheit gab die Politik 1998 den Startschuss für eine weitreichende Autonomie der deutschen Hochschulen. Erstmals liefert nun Christine Burtscheidt einen fundierten Überblick über diesen Umbau. Die große Hochschulreform erweist sich als höchst widersprüchlich und teilweise als bereits gescheitert. Vielfach gelang es den Universitäten nicht, ihre Organisation neu auszurichten. Die Politik steuert im Detail weiterhin kräftig mit. Gleichzeitig finanziert und lenkt der Staat den schärfer werdenden Wettbewerb um zusätzliche Mittel. Und auch die individuelle Freiheit des Wissenschaftlers hat durch den Abbau von Mitspracherechten, die Einführung von umstrittenen Qualitätskontrollen sowie die Reduzierung der Grundfinanzierung abgenommen. Ganz zu schweigen vom Bologna-Prozess, dessen Tendenz zur Vereinheitlichung konträr zu den Reformen steht. Vollmundig hatte die Politik den Hochschulen mehr Autonomie versprochen - heute, zwölf Jahre später, sind sie unfreier denn je.
Autorentext
Christine Burtscheidt, Dr. phil., war langjährige Autorin und Redakteurin der Süddeutschen Zeitung für Schul- und Hochschulpolitik und ist seit August 2010 persönliche Referentin des Präsidenten der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Leseprobe
6.2.7 Neue Lasten in Lehre Kein universitärer Bereich ist seit den 1970er Jahren so detailliert vom Staat gesteuert worden wie die Lehre. Bund und Länder haben sie infolge der ersten großen Expansionswelle der Studenten mit einem dichten Netz an Regeln überzogen, nicht zuletzt auch, um die Unterfinanzierung und die damit einhergehende Mangelverwaltung der Hochschulen in den Griff zu bekommen. Das erste Hochschulrahmengesetz von 1976 spiegelt die Regulierungswut mit seinen vielen Paragraphen zur Lehre und zum Studium wider. Als die Politik Ende der 1990er die Parole "Deregulierung" ausgab, galten die Forderungen nach mehr institutioneller Autonomie besonders der Lehre. An erster Stelle wollten die Hochschulen das Recht zurückhaben, ihre Studenten selbst auszuwählen; auch sollten Prüfungs- und Studienordnungen wieder ausschließlich in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Bund und Länder gaben nach. Gleichzeitig willigten sie jedoch in den Beschluss der EU ein, einen europäischen Hochschulraum zu schaffen, womit wohl die bislang gravierendste Studienreform der Nachkriegszeit ausgelöst wurde. Beide Entwicklungen, der "Bologna-Prozess" und das neue Auswahlrecht, sollen genauer betrachtet werden. 6.2.7.1 Überforderung bei der Zulassung Auf die Frage, was er an den deutschen Universitäten verändern würde, wenn er Bundesbildungsminister wäre, erklärte 1998, zum Start der deutschen Hochschulreform, der damalige Präsident der Stanford University in Kalifornien, Gerhard Casper: "Den Universitäten das Recht geben, ihre Studenten selbst auszuwählen. Nur wenn man die besten Studenten hat, dann kommen auch die besten Professoren." Seit zwölf Jahren ist es den Hochschulen nun wieder erlaubt, sich an der Auswahl ihrer Studenten zu beteiligen. Damit gab die Politik einer seit langem erhobenen Forderung der Rektoren und des Wissenschaftsrates nach. Dieser hatte schon in den 1980er Jahren eine stärkere Selbstbeteiligung der Einrichtungen angemahnt. Zumindest bei den zulassungsbeschränkten, überlaufenen Studiengängen sollten sie ein Mitspracherecht erhalten. Noch in den 1960er Jahren hatten Studenten selbst bestimmen können, welche Hochschule sie besuchen wollten. Einzige Bedingung war der Nachweis des Abiturs - also der Allgemeinen Hochschulreife. Allerdings durften auch die Universitäten bei der Auswahl ein stückweit mitreden. Die generelle Frage nach Zulassungsbeschränkungen stellte sich nicht in einer Zeit, in der bestenfalls fünf Prozent eines Altersjahrgangs studierten. Erst als die Studentenzahlen in den 1970er und 1980er Jahren nach oben schnellten und der Ausbau der Hochschulen damit nicht Schritt hielt, sahen sich immer mehr von ihnen dazu gezwungen, in Fächern wie Medizin oder Jura einen örtlichen Numerus clausus (NC) einzuführen. Allerdings stützten sie sich dabei auf höchst unterschiedliche Verfahrensweisen, so dass es zu Klagen von Bewerbern wegen fehlender Chancengleichheit kam. Die Klagen führten in letzter Instanz 1972 vor das Bundesverfassungsgericht. Die Richter erklärten den NC für verfassungswidrig und beriefen sich dabei auf das Grundrecht auf freie Berufswahl. Das BVerfGG sah nur eine Möglichkeit, den Hochschulen aus der Zwickmühle zu helfen. Wollten sie am NC festhalten, mussten die Länder die Zugangsbedingungen bundesweit nach einheitlichen Kriterien regeln. Die Länder willigten in die Auflagen des höchsten Gerichts ein, schlossen untereinander einen Staatsvertrag über die Modalitäten bei zulassungsbeschränkten Studiengängen ab und gründeten die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, kurz ZVS. Seither verteilte die Dortmunder Behörde die Studienplätze in den stark nachgefragten Fächern wie folgt: Etwa zehn Prozent blieben sozialen Härtefällen, Ausländern oder Zweitstudienbewerbern vorbehalten, der Rest der Plätze wurde zu 60 Prozent nach Abiturnote und zu 40 Prozent nach Wartezeit vergeben. Standardisiert wurde auch die Ermittlung der Ausbildungskapazitäten. Die Studentenmassen sollten auf die immer schlechter ausgestatteten Hochschulen möglichst nach gleichen Gesichtspunkten verteilt werden, schon um juristisch unangreifbar zu bleiben, wenn abgelehnte Bewerber versuchten, Plätze einzuklagen. Dazu wurde für jedes Fach bundeseinheitlich ein Curricularnormwert festgelegt. Multipliziert man diesen mit der Zahl der Stellen, Räume und Betreuungsverhältnisse, ergibt sich daraus bis heute die Summe der Studienplätze. Detailliert schreibt all diese Regeln die Kapazitätsverordnung vor. Ungeachtet der Vorgaben ist die Auslastung in den einzelnen Fächern jedoch äußerst unterschiedlich. Während es in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern nie zum Aufnahmestopp kam, und damit ihr Schicksal als Massenfächer besiegelt war, wurde in den kostspieligeren Fächern wie Medizin oder Biologie ein Numerus clausus eingeführt, um erträgliche Betreuungsverhältnisse zu sichern. Das NC-Urteil des Bundesverfassungsgerichts schränkte die Hochschulen in ihrer Handlungsfreiheit fortan erheblich ein. Weder durften sie noch eigene, fachspezifische Auswahlkriterien beim Zugang geltend machen, noch hatten sie Einfluss auf die Berechnung der Studienplätze. Die Politik hatte sie in der zentralen Frage der Zulassung völlig entmachtet. An Freiheit büßten aber auch die Studenten ein, die in den NC-Fächern kein Recht mehr auf die eigene Wahl des Studienplatzes hatten. Denn diesen teilte ihnen nun die ZVS zu. Juristisch war dies insofern nicht weiter problematisch, weil mit der Einführung des Hochschulrahmengesetzes 1976 die Politik auch Studien- und Prüfungsordnungen mit dem Ziel ihrer Vereinheitlichung unter staatliche Aufsicht stellte. Damit schien die Homogenität des Angebots gewährleistet zu sein, so dass es gleichgültig war, wo man studierte. Bund und Länder hatten somit erheblichen Einfluss auf die originär akademischen Belange der Hochschule erworben. Doch führte die staatliche Regulierung am Ende zum sinkenden Niveau in der Lehre, zu mangelhafter Profilbildung, zu langen Studienzeiten und zu hohen Abbrecherquoten. Zweifellos trug zu all den Defiziten auch der Öffnungsbeschluss von 1977 bei, der die Hochschulen zwang, weiterhin jeden Abiturienten aufzunehmen. Bei gleich bleibendem Personalbestand drängten so immer mehr Studenten in die Hörsäle, was an den Universitäten zu kaum noch zu verantwortenden Betreuungsverhältnissen führte. Doch dagegen konnten sie sich nicht mehr wehren, nachdem ihnen nun durch die Kapazitätsverordnung und den Curricularnormwert Auslastungsgrenzen vorgegeben waren. Protest gegen die ZVS Von Anfang an gab es Widerstand gegen die staatliche Zugangskontrolle. In den 1990er gewann er jedoch nochmals an Fahrt. Professoren und S…